|

Ja zum Bau der Brücke von Schengen
Die 1908 vom Unternehmen Paul Wurth erbaute Brücke war eine Besonderheit
Die ersten von Menschenhand errichteten Brücken waren aus Holz. Den Römern wurden die ersten Steinbrücken zugeschrieben,
und aus England weiss man, daß bereits 1776 gußeiserne Brücken gebaut wurden. In Frankreich wurde die erste Eisenbrücke
im Jahr 1852 errichtet (Pont d'Asnières sur la Seine).
Im Jahr 1827 wurde auf der Strecke Luxemburg-Namur eine gußeiserne Brücke bei Martelange/Sûre von 12 Metern Länge
vorgestellt. Die erste "große Stahlbrücke" in Luxemburg wurde im Jahr 1890 in Wormeldingen auf einer Gesamtlange von 110
Meter über die Mosel gebaut (350 Tonnen). Sie war von Paul Wurth in der "Hollericher Kesselfabrek" entworfen
und konstruiert worden (Atelier Eugene Müller). Für damalige Verhältnisse ein "Meisterwerk".
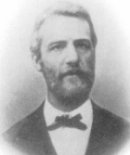 Eugene Müller Eugene Müller
 Paul Wurth Paul Wurth
Bevor man auf den Gedanken kam, eine Brücke über die Mosel zu schlagen, wurden die Menschen mit ihrem
Vieh und Material mittels "Fähren" über den Strom gesetzt. Der Fahrmann (oder auch Passeur" genannt) setzte nach
dem Ruf "Holiwer" mit seiner Fähre oder "Pont" über.
Es gab auch schon sehr lange das
sogenannte "Weistum", ein Dorf und Stadtrecht, das der Dorfgemeinschaft
von Rechtskundigen auf Anfrage "gewiesen" wurde. Da-
nach bestand auf Fähren das Asylrecht. So auch auf der Schengener
Fähre. Wenn ein Verfolgter sich auf die Fähre flüchten konnte, so
wollte es das Recht, durfte er dort während sechs Wochen und drei Tagen
bleiben, ohne daß er festgenommen werden konnte. Gelang es ihm nach
dieser Frist, auch nur drei Schritte an Land zu gehen, begann
seine "Schonzeit" für weitere sechs Wochen.
Wurde der Fährmann von einem "Verfolgten" um Hilfe gebeten,konnte er
den "Gesetzlosen" übersetzen, erst nachdem dieser auf der anderen Seite
in Sicherheit war,konnte der Fährmann zurück, um die "Verfolger"
aufzunehmen. Gedacht war dieses Recht als Hilfe gegen willkürliche
Gewaltherrschaft und vorschnelle Hinrichtungen.
Man sollte annehmen, daß Brücken Länder verbinden, daß sie die Menschen
"sich näherbringen",daß sie besonders in Grenzregionen auch
Sprachschranken überwinden helfen und so zur Volkerverständigung
beitragen. Eigentlich müsste gerade die "Schengener Brücke" im
Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Luxemburg viel dazu beitragen wenn
man auch noch das Saarland und Lothringen berücksichtigt, dann dürfte
sie wohl eine der wichtigsten sein, die Luxemburg mit seinen Nachbarn
verbindet. Seit 1893 wurde verhandelt .Bereits im Jahr 1893 liefen
Verhandlungen zwischen dem Großherzoglich-Luxemburgischen
Generaldirektor des Innern und dem Königlich-Preußischen
Regierungspräsidenten "Hochwohlgeboren" aus Trier zwecks Errichtung
einer Brücke über die Mosel bei Schengen und Perl (D).
Zwecks Festlegung des Durchflußprofils eines ersten Entwurfs wurde die
9 km flußabwärts 1866 erbaute Brücke von Remich von
der Königlichen Wasserbauinspektion Trier herangezogen. Zu Grunde
gelegt wurde der bis dahin höchste bekannte Wasserstand
(Hwmax) aus dem Jahre 1784 (der höchste Wasserstand des Jahrhunderts
war 1844). Im ersten Entwurf wurde die Brückenunterkante
gleich dem HWStand von 1784, der bei 146,594 lag, angegeben (Pegel
Besch). Der Pegel von Besch lag 4 km unterhalb der Baustelle
(Schengen) mit Nullpunkt 139,044 und ergab 1784 einen Wasserstand von
+7,55, das der Höhe 146,594 entspricht. Das Gefälle zwischen Schengen
und Besch aber ist mit 1,1 m anzunehmen, was wiederum 147,694
entspräche, fügt man noch 0,5 m für den sicheren Abfluß treibender
Gegenstände hinzu, ergäbe sich somit eine Brückenunterkante
von 148,194 (148,2).
Königlich-Preußische Einwände
Diese Einwände kamen am
9.Juni 1896 vom Königlich Preußischen Regierungspräsidenten. Es waren
dies damals ganz normale Vorgänge, die natürlich mit ganz anderen
Maßstäben zu bewerten und zu messen sind wie heute. Allein schon aus
der Sicht des Vermessungswesens waren diese Arbeiten zeitlich sehr
aufwendig.
Ebenso verhielt es sich bei Uebermittlung der Ergebnisse von
Besprechungen und Ueberlegungen.
Fast alle aufgefundenen Dokumente und Kopien sind "handgeschrieben" in
der alten deutschen Schrift.
Etwa um die Jahrhundertwende nahm das Projekt konkretere Formen an.
Beide Seiten hatten sich auf die "Anlage einer Brücke mit eisernem
Oberbau über die Mosel bei Schengen" geeinigt. Eine Stahlkonstruktion
war wenige Jahre zuvor (1878) in Grevenmacher abgelehnt worden. In
einem ersten Kostenvoranschlag (20.1.1896) hieß es:
"Auf
Grund der beigefügten Pläne und Profilen soll die Ueberbrückung
vermittels ,fünf' Oeffnungen von einer Gesamtlänge von 180 m
zwischen den Landpfeilern stattfinden. Die lichte Breite erhalt 6,60 m,
wovon 5,0 m für die Fahrbahn und 0,8 m für jedes Trottoir. Globalpreis
= 235 000 Franken."
Daß gerade Grenzbrücken ganz' besonderen Ansprüchen und Vorschriften unterliegen, ist eine bekannte Tatsache, die leider auch
ihre Schattenseiten hat. Das sollte auch bei der "Schengener" nicht anders sein.
Am 9. Juni 1896 sagt der Königlich Preußische Regierungspräsident Von Heppe in einem Schreiben an den Generaldirektor
des Innern in Luxemburg, Herrn Kirpach:" Im Interesse der Landesverteidigung ist die Brücke (Schengen)
im 1. und 2. Landpfeiler vom rechten Ufer aus gerechnet mit Minenanlagen zu versehen
(das erklärt auch weshalb die rechte Seitenöffnung [Perl] und der Mittelbogen bei der Sprengung einstürzten,
während die linke Seitenöffnung weitgehend unbeschädigt blieb) und ferner entsprechend den Anlagen
an der Brücke von ,Grevenmacher' zwischen dem 2. und 3. Landpfeiler quer über die Brücke ein Gittertor anzubringen,
sowie auf dem rechten Ufer ein ,Warthaus' zuerbauen, von welchem aus die Bestreichung der Brücke
und des linken Ufers möglich ist . . ." Weiter heißt es: "ln Betreff der Einzelheiten der militarischen Anlagen wird es nicht
zu umgehen sein, daß sich die Bauleitung mit der 7. Festungsinspektion zu Coeln, welche entsprechende Anweisung erhalten hat,
unmittelbar ins Benehmen setzt."
Strategische Forderungen
Es mutet in unserer Zeit merkwürdig an, wenn der Historiker (Aus Grenzvermessung Deutschland-Luxemburg 1984,
Heinz Weber) feststellt, daß es für dieses Vorgehen sogar eine "Rechtsgrundlage" gab. Beim Bau der Moselbrücke
"Grevenmacher-Wellen" durch die Stadt Grevenmacher hatte die Konigliche Regierung in Trier in der Depesche
vom 2. Januar 1880 der luxemburgischen Regierung mitgeteilt, daß sie aus Artikel 27 des Grenzvertrages
vom 26.Juni 1816 auch strategische Forderungen herleitet.Für den Fall der Mobilmachung oder des Kriegszustandes
in dem anstoßenden deutschen Gebiet wird sich das Recht jederzeitiger militärischer Besetzung und eventueller
Sprengung oder Zerstörung der Brücke ohne andere Entschädigung vorbehalten als die die für Kriegsschäden
nach den Gesetzen des deutschen Reiches gewährt wird.
Bemerkenswert ist ein Schreiben von Paul Wurth an den Generaldirektor des Innern, Herrn Kirpach, vom 14. Januar 1905.
Hierin heißt es unter anderem: ". . . Ich bemerke, dass.. das Projekt, welches ich bereits vor mehreren Jahren ausgearbeitet
habe, nicht nur vom Gemeinderat Remerschen, zuerst am 8.12.1894, dann am 20.1.1896 einstimmig genehmigt
worden war, sondern ... schließlich auch die Zustimmung der deutschen Behörden ... erhalten hatte."
Abschließend bemerkte Paul Wurth, und das ist in unserer heutigen Zeit erwähnenswert, ". . . daß sämtliche Materialien zu
meinem Projekt aus dem Lande bezogen werden, und bitte Sie, die inländische Industrie bei der Vergabe
vor der ausländischen berücksichtigen zu wollen".
Billiger aIs geplant
Nach langem Hin und Her wurde der Entwurf Paul Wurth schließlich zurückbehalten. Der Gesamtpreis war
veranschlagt mit 350 000 Franken. Davon entfielen auf Schengen 4/7 Remerschen 2/7 und Wintringen 1/7. Die Gemeinde
mußte 170 000 Franken leihen, und die Regierung steuerte ein Subsid von 125 000 Franken bei
Die Schlußrechnung der Firma Paul Wurth vom 30. Juni 1908 belief sich
auf 341032 F.
Die von Paul Wurth entworfene und in der "Hollericher Kesselfabrek"
hergestellte Brücke hatte eine Gesamtlänge
von 150 m (im Gegensatz zum ersten Entwurf mit 180m). Die beiden Seitenbrücken waren je 40 m lang, und das Mittelteil
mit dem 14 m hohen Bogen hatte eine Länge von 70 m. Es ist heute sehr schwer nachzuvollziehen, wie eine solche
Brücke, mit einem Gesamtgewicht von 430 t, in einem kleinen Werk wie der damaligen "Kesselfabrek" entstanden ist.

M.Ernsdorf, M.P.Schmit,M.Beissel,Dr.P.Zender,M.Alex Welter, +unbekannt
Umweg über Thionville
Seit 1896 war die
Kesselfabrik an das Eisenbahnnetz angeschlossen. Um nach Schengen resp.
nach Perl (Deutschland) zu gelangen, musste der Umweg über das damals
deutsche Diedenhofen (Thionville) moselabwärts (rechtsseitig) erfolgen
. Moselabwärts bestand schon seit vielen Jahren die Eisenbahn von Metz
bis Trier .Auch das Luxemburger Eisenbahnnetz unterstand der
Kaiserlichen Generaldirektion der Eisenbahnen in Elsaß-Lothringen in
Straßburg.Aus diesem Transportgrund wurde die "Schengener Brücke" von
der Perler Seite her montiert was auch eindeutig aus der Beschreibung
des Montagegerüstes hervorgeht. Es ist allerdings nicht
auszuschließen, daß auch Teile (z. B. Nieten und anderes
Montagezubehör) mit Pferdefuhrwerken von Luxemburg nach Schengen
transportiert wurden, ältere Paul Wurth-Leute erzählten jedenfalls von
Transporten an die Mosel mittels Pferdefuhrwerken. Ob es aber
nach Schengen war, ist nicht eindeutig geklärt.
Eine Besonderheit
Die Schengener Brücke mit ihrem hohen Mittelbogen stellte eine
Besonderheit dar. Bereits die Vorbereitung und Einrichtung der
Baustelle mußte sorgfältig überlegt sein, denn der Brückenbau in der
damaligen Zeit war ein "Zusammenbau vor Ort", d. h., alle
Knotenpunkte wurden an Ort und Stelle "genietet', was Kenntnis und
Geschicklichkeit erforderte. Die "Nieten" wurden ebenfalls in
der "Hollericher Kesselfabrek" hergestellt und an die Baustelle
geliefert.Vorerst musste ein "Montierungsgerüst"
berechnet und montiert werden. Es bestand aus einer Rüstung fur die
"Mittelöffnung" (70m) und Rüstungen für die beiden
seitlichen Oeffnungen (je 40 m). Das Untergerüst der Mittelöffnung
reichte bis zur Fahrbahn und trug 7m über dem Belag die Laufbahn
eines Montagekranes. Das Obergerüst ruhte auf der Unterrüstung und
paßte sich in seinem oberen Teil dem Linienzug des Bogenuntergurtes an.
Da der Bogen zuerst montiert wurde, mußte die Seitenöffnung auf der
Perler Seite (D), von wo die
Materialzufuhr erfolgte, schon bei Beginn der Montierung "eingerüstet"
werden, Die Parallelträgerbrücke auf der Schengener Seite
wurde zuletzt montiert. Daher konnte das Material der Oberrüstung für
die Mittelöffnung zum Einrüsten dieser Brücke verwendet werden. In der
Mitte der "Stromöffnung" wurde eine 9 m breite Oeffnung für die
Schiffahrt freigehalten, die mit roten Flaggen
bzw. Laternen bezeichnet war.
Montagegerüst, war Kunstwerk
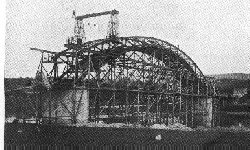 Für die Belastungsberechnung wurden Dimensionen und Gewichte der größten einzubauenden Konstruktionsteile in Betracht
gezogen: Hauptträger der Mittelöffnung: 35 t Schwerstes Querstück 10 m: 4,5 t Quertäger 6 m: 1,03 t,Zugband: 0,2 t/m.
Der Montierungskran hatte zwei Katzen für je 3 t Nutzlast, deren Gewicht mit je 0,5 t zu Buche schlug.
Das Eigengewicht des Krans betrug 6,8 t (Radstand 4,0 m). Der maximale Raddruck aus Nutzlast und Krangewicht
betrug 4,6 t. Auf dem Gerüst wurde ein Feldbahngleis verlegt, worauf ein Transportwagen,
dessen Gewicht inklusive Nutzlast 3,2 t betrug, die Einzelteile auf der Baustelle beförderte. Das Montagegerüst war, so abwegig
es auch erscheinen mag, das eigentliche Kunstwerk. Bei der Montage der Stahlkonstruktion war nur "ein" besonders
ungünstiger Belastungsfall genauestens zu behandeln, und zwar wenn der Fachwerkbogen je zur Hälfte aufgelegt,
jedoch am Scheitel noch nicht verbunden war.Um das zu bewerkstelligen, mussten die beiden Fachwerkhälften,
welche über den einzelnen Jochstempeln unterkeilt auf dem Gerüst ruhten, um den Zusammenbau am Scheitel zu ermöglichen,
um ihren Auflagerpunkt entweder auf- oder abwärts geschwenkt werden. Je genauer die Montage von unten her gemacht wurde
, um so einfacher war auch der Zusammenbau am Scheitel. Und das war die eigentliche Spezialität des Brückenbauers.
Hut ab vor solch großartigen Leistungen!
Für die Belastungsberechnung wurden Dimensionen und Gewichte der größten einzubauenden Konstruktionsteile in Betracht
gezogen: Hauptträger der Mittelöffnung: 35 t Schwerstes Querstück 10 m: 4,5 t Quertäger 6 m: 1,03 t,Zugband: 0,2 t/m.
Der Montierungskran hatte zwei Katzen für je 3 t Nutzlast, deren Gewicht mit je 0,5 t zu Buche schlug.
Das Eigengewicht des Krans betrug 6,8 t (Radstand 4,0 m). Der maximale Raddruck aus Nutzlast und Krangewicht
betrug 4,6 t. Auf dem Gerüst wurde ein Feldbahngleis verlegt, worauf ein Transportwagen,
dessen Gewicht inklusive Nutzlast 3,2 t betrug, die Einzelteile auf der Baustelle beförderte. Das Montagegerüst war, so abwegig
es auch erscheinen mag, das eigentliche Kunstwerk. Bei der Montage der Stahlkonstruktion war nur "ein" besonders
ungünstiger Belastungsfall genauestens zu behandeln, und zwar wenn der Fachwerkbogen je zur Hälfte aufgelegt,
jedoch am Scheitel noch nicht verbunden war.Um das zu bewerkstelligen, mussten die beiden Fachwerkhälften,
welche über den einzelnen Jochstempeln unterkeilt auf dem Gerüst ruhten, um den Zusammenbau am Scheitel zu ermöglichen,
um ihren Auflagerpunkt entweder auf- oder abwärts geschwenkt werden. Je genauer die Montage von unten her gemacht wurde
, um so einfacher war auch der Zusammenbau am Scheitel. Und das war die eigentliche Spezialität des Brückenbauers.
Hut ab vor solch großartigen Leistungen!

Kesselfabrek um 1890
Im Gemeinderat Remerschen waren damals Bürgermeister Chr.Koch, die Schöffen J. Wallerich, Jacob Schumacher
sowie die Räte L. Schons, J.-P. Useldinger, J.-P.' Wiltzius, J. Bellwald und J.-P. Oudill,
Sekretär war Kons (Unterschriften auf Originalzeichnung).
Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurden die Grenzwasserläufe Our, Sauer und Mosel von 21 Brücken uberquert
(Our 8, Sauer 9 und Mosel 4) Sie waren von luxemburgischen oder preußischen Gemeinden errichtet worden oder waren
Gemeinschaftswerke beider Staaten Die älteste war die Brücke von Rodershausen - Dasburg aus dem Jahr 1846 .
Sie erreichte das "Ausnahmealter" von fast 100 Jahren Im September 1944 haben deutsche Pioniere alle (?) Grenzbrücken zerstört
über die Mosel führten vier Brücken Grevenmacher-Wellen, erbaut 1881, zerstört 1944, neu erbaut 1959; Wormeldingen-Winch,
erbaut 1890, zerstört 1944, neu erbaut 1963; Remich-Nennig, erbaut 1866, zerstört 1944, neu erbaut 1959,
Schengen-Perl, erbaut 1908, zerstört 1939, neu erbaut 1959
Eine (traurige) .Ausnahme machte hier die eiserne Brücke von Schengen Sie wurde bereits kurz nach Ausbruch des
Zweiten Weltkrieges am 15 September 1939 gesprengt Ursache war ohne Zweifel ihre "strategisch wichtige" Lage
im Dreiländereck. Schengen hatte für 20 Jahre keine Brücke mehr .
Quellennachweis Archiv Paul Wurth S A -
Kesselfabrek Infoblatt Amicale Paul Wurth .
Siehe Luxemburger Wort vom 28.6.1997
|